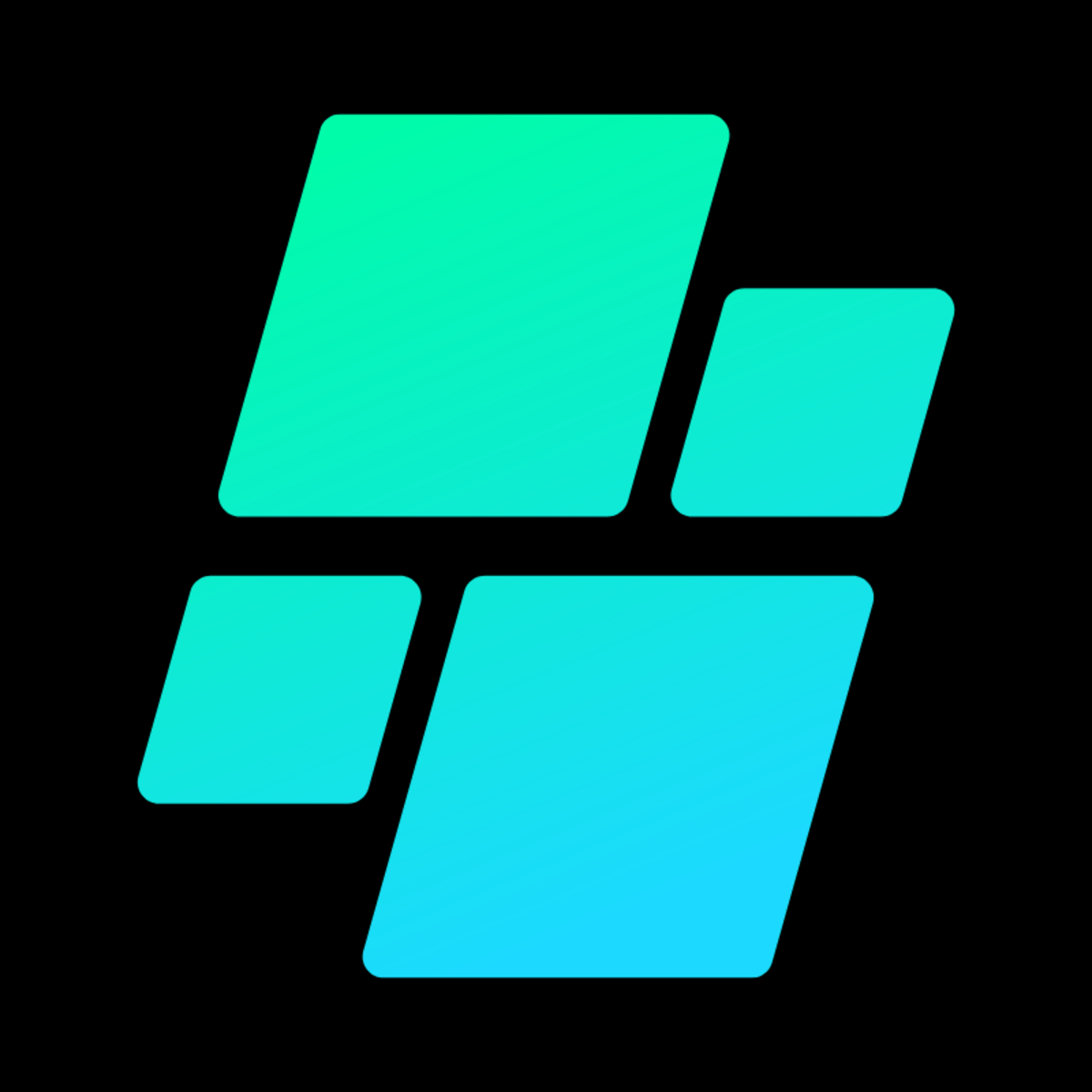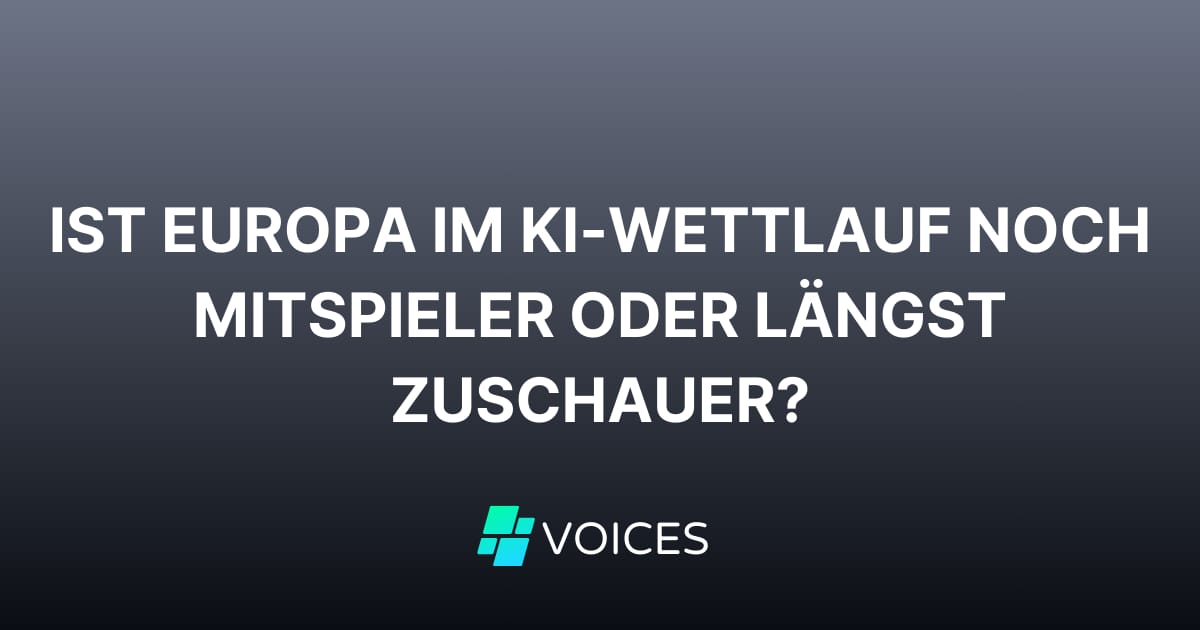Deutschlands #1 KI-Newsletter
Mit KI Weekly Voices starten wir ein neues kostenfreies Format bei KI Weekly: renommierte Stimmen aus Wirtschaft, Forschung, Politik und Technologie, die Künstliche Intelligenz gestalten, nutzen und kritisch hinterfragen.
Fünf Persönlichkeiten, eine Frage und ein Thema, das uns alle betrifft: die Zukunft mit KI. Ihre Antworten sind präzise, ehrlich und oft überraschend.
KI Weekly Voices ergänzt die Sonntagsausgabe von KI Weekly und erscheint im zweiwöchentlichen Rhythmus, jeweils am Mittwoch. Jede Ausgabe vereint die klügsten Gedanken und prägnantesten Einsichten – sorgfältig ausgewählt, pointiert und lesenswert.
Guten Morgen, 🌞
Ist Europa im globalen KI-Wettlauf noch Mitspieler oder längst Zuschauer?
Das haben wir dutzende Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gefragt und hier sind die besten fünf Antworten:
- 01 -
Prof. Dr. Andreas Dengel

Foto: Uwe Völkner/Fotoagentur FOX
„Wer die Cloud kontrolliert, kontrolliert die KI-Industrie – vom Training großer Sprachmodelle bis hin zum Betrieb datenintensiver Anwendungen.“
Europa verliert nicht den Wettlauf um kluge Köpfe, sondern den um den Besitz physischer und digitaler Infrastruktur. Genau dort wird heute Rendite erwirtschaftet. Wer über Rechenkapazitäten, Chips und Cloud-Plattformen verfügt, kann Preise, Zugänge und Innovationsgeschwindigkeit bestimmen.
Politik und Industrie behandeln KI in vielen Fällen noch wie eine Software-Schicht, die man einfach „hinzufügen“ kann. Das ist aber zu kurz gegriffen, denn vielmehr ist der KI-Boom an einer Energie- bzw. Infrastruktur-Ökonomie festgemacht: Rechenleistung ist der Brennstoff, Rechenzentren sind die Kraftwerke. Wer über „Compute“ verfügt, steuert die Wertschöpfungsketten – vom Training über den Betrieb bis zur Monetarisierung.
Wenn Europa seine digitale Souveränität sichern will, braucht es eine industrielle Strategie, die über Forschung hinausgeht.
Nur so lässt sich verhindern, dass europäische Innovationen dauerhaft auf fremden Infrastrukturen betrieben und monetarisiert werden. Europa verliert nicht, weil es zu wenig forscht. Es verliert, weil es zu wenig besitzt. Souveränität in der KI bedeutet nicht, mehr Paper zu veröffentlichen, sondern die Kontrolle über die Infrastruktur zu gewinnen, auf der diese Technologien laufen.
Die komplette Antwort kannst du hier lesen.
- 02 -
Prof. Dr. Gitta Kutyniok

Foto: Prof. Dr. Gitta Kutyniok
… leitet an der LMU München die bayerische KI-Professur „Mathematical Foundations of Artificial Intelligence“ und verbindet Spitzenforschung in angewandter Mathematik mit KI-Entwicklung. Ihre Arbeit wird weltweit gewürdigt.
„Europa ist im globalen KI-Wettlauf nach wie vor Mitspieler, aber definitiv nicht Taktgeber.“
Die wissenschaftliche Basis, die starken Industrien, der hohe Anspruch an Datenschutz und Sicherheit und allgemein die Einhaltung europäischer Werte sind klare Stärken, doch andere Regionen investieren schneller und deutlich mehr. In Europa dauern Abstimmungsprozesse oft lange, und wichtige Initiativen verlieren dadurch an Geschwindigkeit. Das mindert nicht die Qualität der Forschung, aber es verlangsamt ihren Weg in Anwendung und Markt und erhöht das Risiko, bei zentralen Schlüsseltechnologien von externen Akteuren abhängig zu werden.
Um seine Rolle zu stärken, braucht Europa mehr Pragmatismus, Entschlossenheit und Mut, Innovationen zügiger umzusetzen. Technologische Souveränität spielt dabei eine zentrale Rolle: Europa muss in strategisch wichtigen Bereichen – von KI-Infrastruktur über Datenräume bis hin zu Hochleistungsrechenkapazitäten – eigenständig handlungsfähig bleiben.
Ein etwas größerer Spielraum für Risiko, ohne die eigenen Prinzipien aufzugeben, könnte helfen, vorhandene Potenziale besser zu nutzen. In diesem Zusammenhang bietet die Entwicklung deutlich energieeffizienterer und damit nachhaltigerer, disruptiv neuer KI-Technologien eine vielversprechende Perspektive, da sie sowohl den Anspruch an Verantwortung und Nachhaltigkeit stärkt als auch einen Beitrag zu größerer digitaler Souveränität leisten kann.
Die komplette Antwort kannst du hier lesen.
- 03 -
Dr. Carolin Wagner

Foto: Susie Knoll
… ist Bundestagsabgeordnete der SPD und eine der prägenden Stimmen für Digitalpolitik im Deutschen Bundestag. Sie hat für die aktuelle Regierungskoalition den Bereich Digitales im Koalitionsausschuss mitverhandelt und setzt sich konsequent für eine zukunftsorientierte Technologiepolitik ein.
„Der globale KI-Wettlauf ist Sprint und Dauerlauf in einem — Europa schnauft derzeit, kann aber auf seine hervorragende Kondition setzen.“
Mit dem AI-Act hat die EU eine Vorreiterrolle in Sachen menschenzentrierter KI eingenommen und eine rechtliche Blaupause geschaffen, die mit einem risikobasierten Ansatz Verantwortungen und Pflichten von KI-Anbietern und Betreibern festlegt. Andere KI-Nationen folgen diesem Beispiel, wie ein Blick nach Indien zeigt, wo kürzlich eigene AI Governance Guidelines vorgestellt wurden.
Auch bei KI-Infrastruktur bleibt Europa am Ball — dabei dürfen wir jedoch nicht die Spielstrategie von China oder den USA kopieren, sondern müssen unsere eigene Taktik finden. Aktuell gehen mit AI-Factories ein enormer Flächen- und Energieaufwand einher — darin kann keine zukunftsfähige Lösung liegen! Die Stärke der EU liegt gerade darin, Innovationstreiber hervorzubringen — viele kluge Köpfe im Silicon Valley kommen aus Europa. Wir müssen diese Tech-Brains hier halten, ihnen beste Rahmenbedingungen bieten, damit die nächsten Entwicklungssprünge Made in EU entstehen — das steht ganz oben in der Strategie, wie Europa sicherlich erfolgreich durchs Ziel geht!
- 04 -
Prof. Björn W. Schuller

Foto: http://www.schuller.one/
…. ist Lehrstuhlinhaber für Health Informatics an der TU München und Professor für Künstliche Intelligenz am Imperial College London. Als Mitgründer des Start-ups audEERING sowie Fellow der IEEE und ISCA zählt er zu den weltweit führenden Forschern im Bereich Maschinelles Lernen, automatischer Sprachanalyse und Affective Computing.
„Europa ist also noch Mitspieler, aber ohne strategische Kehrtwende droht die Zuschauerrolle.“
Ist Europa also vor allem anwendungsorientiert – und gibt es mehr als Regeln und Pläne? In der Tat hat Europa immer wieder zentrale theoretische Beiträge zur KI geleistet. Aus meiner Heimatstadt München kamen etwa rekurrente neuronale Netze mit längerem Kurzzeitgedächtnis (LSTM-RNN, TUM) ebenso wie Stable Diffusion (LMU) – zentrale Beiträge zu dem, was wir heute als Deep Learning und generative KI kennen.
Und natürlich entstanden in ganz Europa bedeutsame Grundlagenarbeiten. So wurden etwa neuronale Sprachmodelle, die einen Grundstein heutiger LLMs legten, maßgeblich von europäischen Forschenden entwickelt – allerdings überwiegend während ihrer weiteren Karriere in den USA.
Europa ist also noch Mitspieler, aber ohne strategische Kehrtwende droht die Zuschauerrolle.
Wenn wir Talente halten, offene Recheninfrastruktur aufbauen, mutiger in skalierbare KI-Unternehmen investieren und Regulierung als Standortvorteil statt als Innovationsbremse nutzen, kann Europa eine eigene, starke Rolle einnehmen: als Kontinent, der leistungsfähige KI mit klaren Werten und gesellschaftlichem Nutzen verbindet – gerade in sensiblen Bereichen wie Gesundheit, Bildung und öffentlicher Daseinsvorsorge.
Ohne diese Anstrengung werden wir zwar weiter über KI reden – aber immer häufiger über Technologien, die anderswo entschieden wurden.
Die komplette Antwort kannst du hier lesen.
- 05 -
Prof. Gerard de Melo
… ist Professor und Lehrstuhlinhaber für Artificial Intelligence and Intelligent Systems am Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam. Als Mitglied des Research Focus Cognitive Sciences der Universität Potsdam sowie der ELLIS Unit Potsdam zählt er zu den international anerkannten Experten für Künstliche Intelligenz, Wissensrepräsentation und intelligente Systeme.
„Europa spielt in der Künstlichen Intelligenz weiterhin mit, aber nicht unbedingt in der ersten Liga.“
Stark ist Europa insbesondere bei gewissen Schlüsseltechnologien, etwa den für die globale Chipproduktion unerlässlichen Lithografie-Maschinen des niederländischen Unternehmens ASML. Wenn wir unseren Wohlstand in einer zunehmend von KI geprägten Welt sichern wollen, brauchen wir jedoch ambitionierte neue Maßnahmen. Der globale Wettlauf um weltweit führende KI-Modelle wird derzeit klar von amerikanischen sowie chinesischen Unternehmen dominiert. Europa kämpt dabei unter anderem mit Problemen wie begrenztem Risikokapital, hohen Energiekosten sowie einer insgesamt geringer ausgeprägten Innovationskultur.
Dennoch ist die Lage keineswegs aussichtslos. Europa hat bedeutende Beiträge zur KI-Grundlagenforschung geleistet. Auch außerhalb des Kontinents liefern europäische Forschende essenzielle Beiträge: So geht etwa das dem ChatGPT zugrundeliegende Transformer-Modell maßgeblich auf Ideen von Jakob Uszkoreit zurück, die er bei Google verwirklichen konnte. Neue wissenschaftliche Durchbrüche könnten eine nächste Generation von KI hervorbringen, bei der Europa wieder Boden gutmacht.
Spannende Diskussionen zu diesen wichtigen Herausforderungen erwarten wir auf der AI@HPI-Konferenz, welche vom 2.-4. Dezember in Potsdam stattfindet.
Welche Frage sollen wir als Nächstes stellen?
Wir lesen jede einzelne Nachricht und Dein Feedback fließt in die nächste Ausgabe ein – klicke auf den Button unten, um deine Frage einzureichen.
Was ist Deine Antwort auf die Frage? 👇
Teile deine Meinung zum Thema, indem du unten einen Kommentar schreibst.
Das war’s schon! 😔
Mehr davon? Hol dir jetzt KI Weekly Plus (kostenlos testen!).