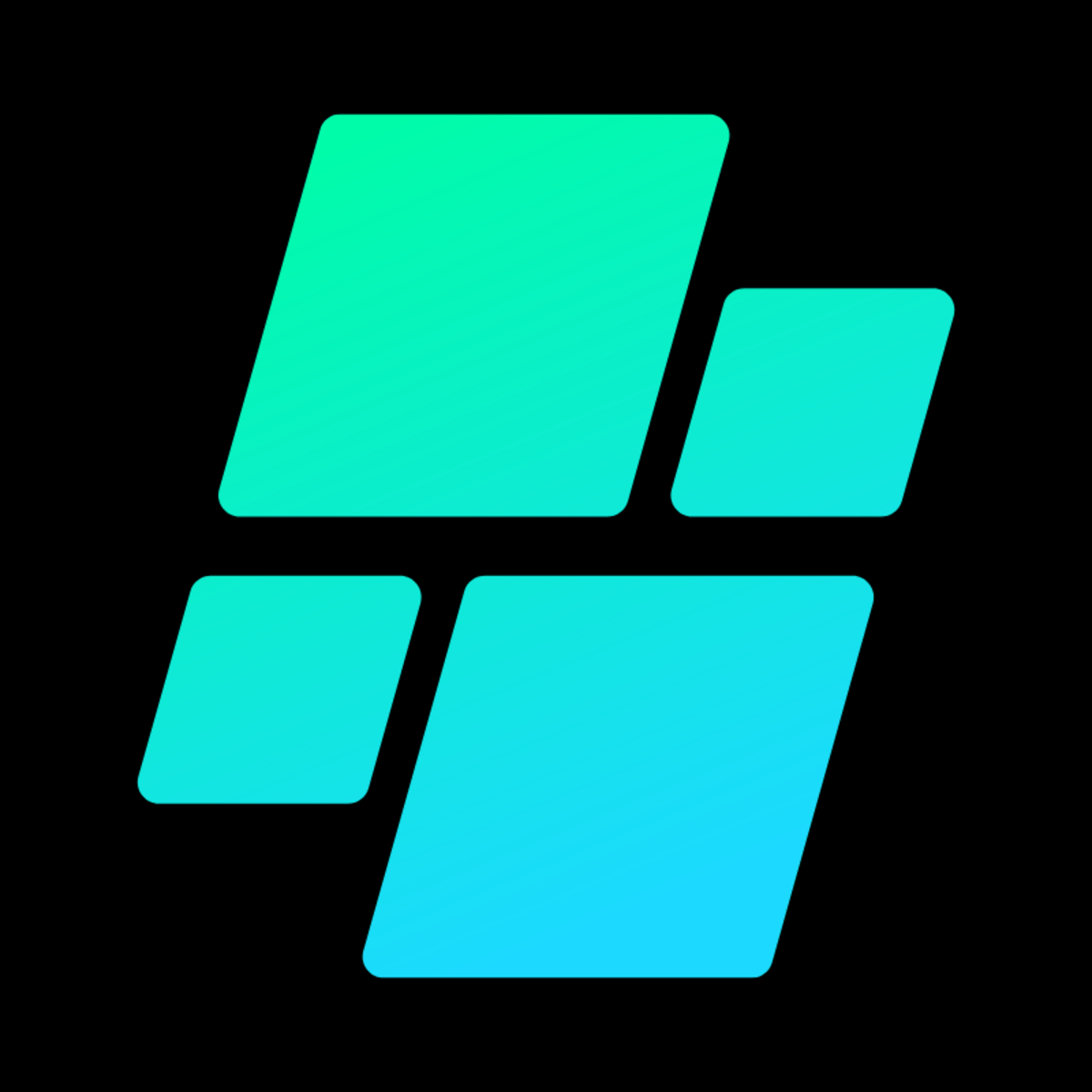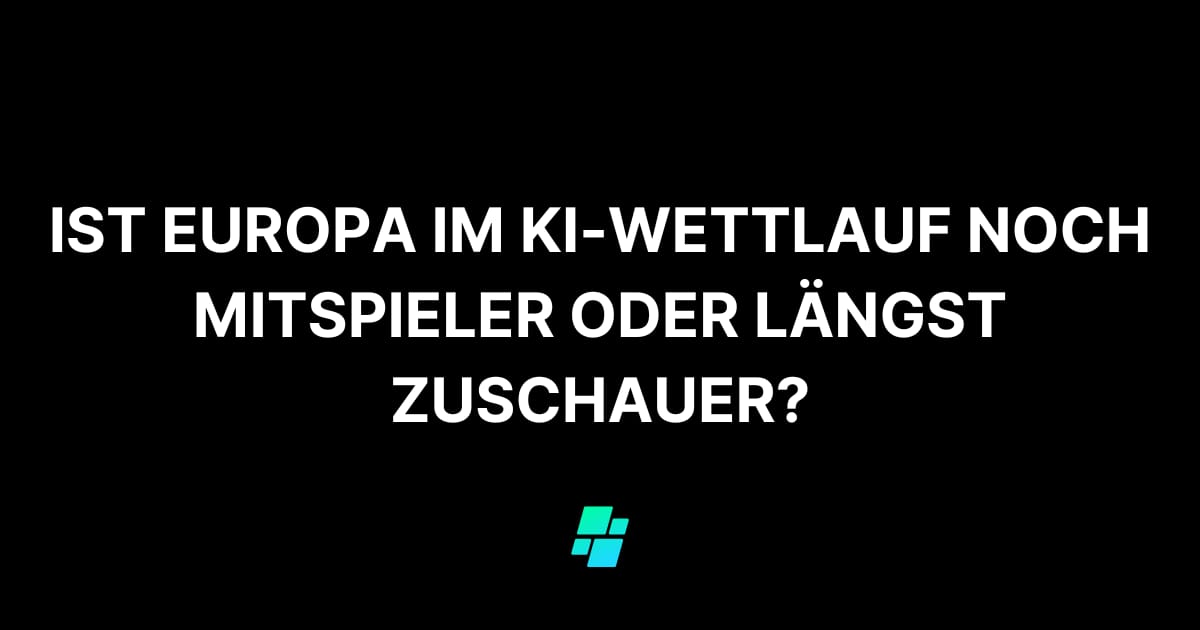Deutschlands #1 KI-Newsletter
Mit KI Weekly Voices starten wir ein neues kostenfreies Format bei KI Weekly: renommierte Stimmen aus Wirtschaft, Forschung, Politik und Technologie, die Künstliche Intelligenz gestalten, nutzen und kritisch hinterfragen.
Vier Persönlichkeiten, eine Frage und ein Thema, das uns alle betrifft: die Zukunft mit KI. Ihre Antworten sind präzise, ehrlich und oft überraschend.
Guten Morgen Herr Prof. Dengel, 🌞
Ist Europa im globalen KI-Wettlauf noch Mitspieler oder längst Zuschauer?
Das haben wir Andreas Dengel, geschäftsführender Direktor des Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und international führender KI-Forscher, gefragt. Er ist Träger zahlreicher Auszeichnungen und Pionier an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft.
Europa zählt zweifellos zu den globalen Zentren der KI-Forschung. Spitzenuniversitäten, renommierte Forschungsinstitute und ein breites Ökosystem aus Start-ups sorgen für wissenschaftliche Exzellenz, neue Modelle und grundlegende Innovationen.
Doch die entscheidende Schwachstelle liegt nicht in den Ideen, sondern in der Infrastruktur. Es ist festzustellen, dass die Grundlagen in europäischen Forschungsinstitutionen und Universitäten gelegt werden, die eigentliche Wertschöpfung aber sozusagen „downstream“ stattfindet, also in der großskaligen Anwendung, im Betrieb und in der Kommerzialisierung von KI-Modellen. Und dort dominieren die bekannten Akteure aus den USA.
Über 65 Prozent des weltweiten Cloud-Markts werden von nur drei US-Anbietern kontrolliert: Amazon Web Services (AWS) mit rund 31 Prozent, Microsoft Azure mit etwa 25 Prozent und Google Cloud mit gut 11 Prozent. Diese Infrastruktur ist das Fundament der modernen KI. Wer die Cloud kontrolliert, kontrolliert die KI-Industrie – vom Training großer Sprachmodelle bis hin zum Betrieb datenintensiver Anwendungen.

Uwe Völkner/Fotoagentur FOX
„Europa verliert nicht den Wettlauf um kluge Köpfe, sondern den um den Besitz physischer und digitaler Infrastruktur.“
Die Auswirkungen dieses Ungleichgewichts sind selbst in den selbsternannten Vorzeigeprojekten Europas erkennbar. Ein Beispiel ist das französische Unternehmen Mistral, das im April 2023 von den KI-Forschern gegründet wurde, die zuvor bei DeepMind und Meta beschäftigt waren. Mistral steht für europäische Spitzenforschung, doch die Modelle werden in US-Rechenzentren trainiert und betrieben und sind durch US-Kapital finanziert. Ähnlich sieht es bei vielen großen deutschen DAX-Unternehmen aus, wie auch dem größten europäischen Softwarekonzern SAP. Das Unternehmen setzt zwar stark auf KI, nutzt dafür jedoch die Rechenleistung von AWS, Azure oder Google Cloud. Souveränität sieht anders aus.
Aleph Alpha, das 2019 mit größter Medienaufmerksamkeit als „Europas Antwort auf OpenAI“ ausgerufen wurde, war ein wichtiger Versuch, dass souveräne KI möglichst unter europäischem Hoheitsgebiet und Recht stattfindet. Leider sind bisher Umsatz und Marktdurchdringung bei weitem hinter den Erwartungen geblieben. Dies macht deutlich, wie wettbewerbsintensiv der Markt großer Sprachmodelle ist, in dem starke US-Konkurrenten, mit enormer Compute Power, es europäischen Anbietern schwer machen, sich zu positionieren.
Europa verliert nicht den Wettlauf um kluge Köpfe, sondern den um den Besitz physischer und digitaler Infrastruktur. Genau dort wird heute Rendite erwirtschaftet. Wer über Rechenkapazitäten, Chips und Cloud-Plattformen verfügt, kann Preise, Zugänge und Innovationsgeschwindigkeit bestimmen.
Politik und Industrie behandeln KI in vielen Fällen noch wie eine Software-Schicht, die man einfach „hinzufügen“ kann. Das ist aber zu kurz gegriffen, denn vielmehr ist der KI-Boom an einer Energie- bzw. Infrastruktur-Ökonomie festgemacht: Rechenleistung ist der Brennstoff, Rechenzentren sind die Kraftwerke. Wer über „Compute“ verfügt, steuert die Wertschöpfungsketten – vom Training über den Betrieb bis zur Monetarisierung.
Wenn Europa seine digitale Souveränität sichern will, braucht es eine industrielle Strategie, die über Forschung hinausgeht. Dazu gehören:
eigene Public-Compute-Layer in Hyperscale-Dimension,
klare Regelungen zur Datennutzung bei öffentlich finanzierter Forschung,
und offene, interoperable KI-Architekturen, die Abhängigkeiten minimieren.
Nur so lässt sich verhindern, dass europäische Innovationen dauerhaft auf fremden Infrastrukturen betrieben und monetarisiert werden. Europa verliert nicht, weil es zu wenig forscht. Es verliert, weil es zu wenig besitzt.
Souveränität in der KI bedeutet nicht, mehr Paper zu veröffentlichen, sondern die Kontrolle über die Infrastruktur zu gewinnen, auf der diese Technologien laufen.
Welche Frage sollen wir als Nächstes stellen?
Wir lesen jede einzelne Nachricht und Dein Feedback fließt in die nächste Ausgabe ein – klicke auf den Button unten, um deine Frage einzureichen.
Das war’s schon! 😔
Mehr davon? Hol Dir jetzt KI Weekly Plus (kostenlos testen!).