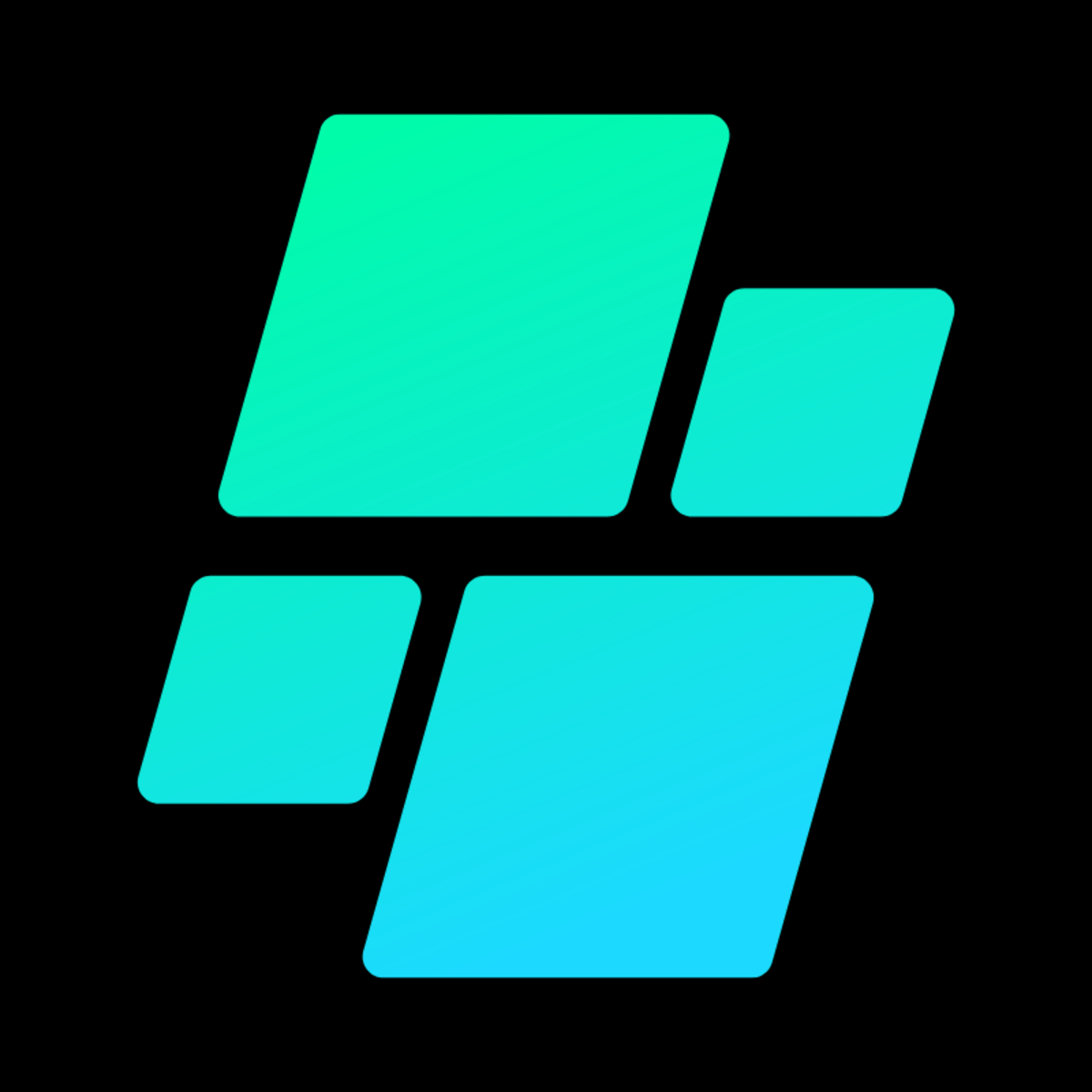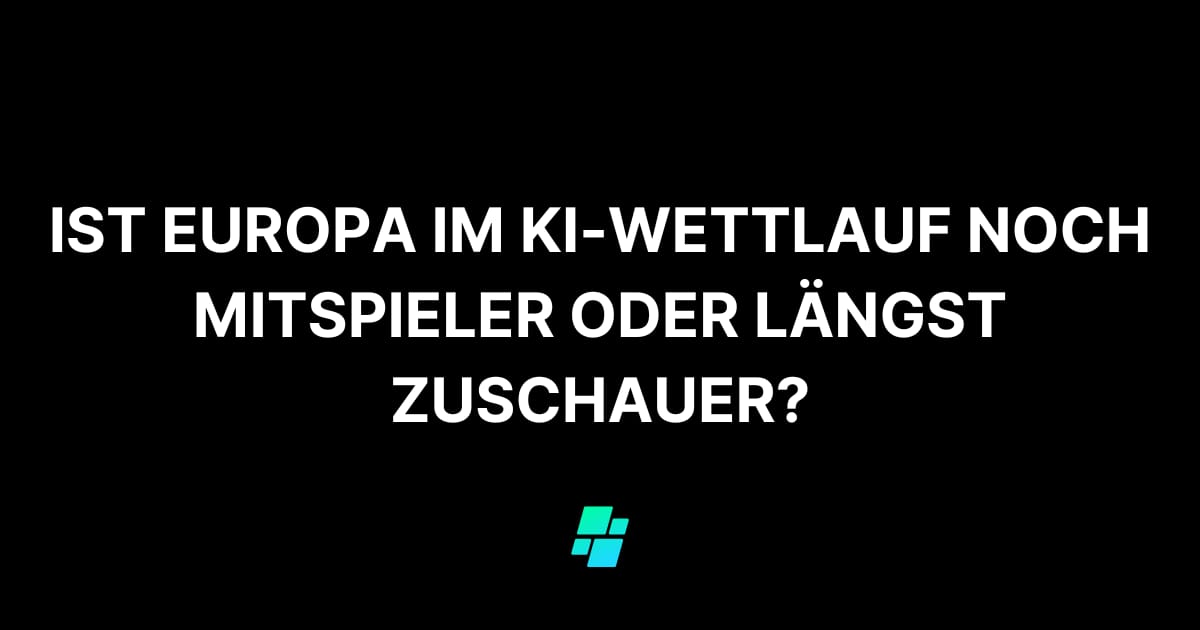Deutschlands #1 KI-Newsletter
Mit KI Weekly Voices stellen wir renommierte Stimmen aus Wirtschaft, Forschung, Politik und Technologie vor, die Künstliche Intelligenz gestalten, nutzen und kritisch hinterfragen.
Vier Persönlichkeiten, eine Frage und ein Thema, das uns alle betrifft: die Zukunft mit KI. Ihre Antworten sind präzise, ehrlich und oft überraschend.
Guten Morgen Herr Prof. Schuller, 🌞
Ist Europa im globalen KI-Wettlauf noch Mitspieler oder längst Zuschauer?
Das haben wir Prof. Björn Schuller, Lehrstuhlinhaber für Health Informatics an der TU München und Professor für KI am Imperial College London, gefragt. Er zählt zu den weltweit führenden Forschern für Maschinelles Lernen, Sprachanalyse und Affective Computing und prägt mit seinen Arbeiten am Munich Center for Machine Learning sowie als Mitgründer des KI-Unternehmens audEERING die internationale KI-Entwicklung entscheidend mit.
Während eines Vortrags zeigte ein Kollege kürzlich halb scherzhaft eine Weltkarte: Über den USA stand „Chips & Compute“, über China „Open Models“ und über Europa „Regulation“ – der globale Süden war unbeschriftet leer. Die Wirtschaftswoche erklärte die EU schon im Mai dieses Jahres zum Abgehängten im Rennen um die KI-Vormacht. Gleichzeitig ist die EU neben dem AI Act eindeutig ambitioniert: „Invest AI“, „Apply AI“ und der umfassende EU AI Continent Action Plan zeigen, dass man mehr will als nur Leitplanken zu setzen.

Foto: http://www.schuller.one/
„Europa ist also noch Mitspieler, aber ohne strategische Kehrtwende droht die Zuschauerrolle.“
Ist Europa also vor allem anwendungsorientiert – und gibt es mehr als Regeln und Pläne? In der Tat hat Europa immer wieder zentrale theoretische Beiträge zur KI geleistet. Aus meiner Heimatstadt München kamen etwa rekurrente neuronale Netze mit längerem Kurzzeitgedächtnis (LSTM-RNN, TUM) ebenso wie Stable Diffusion (LMU) – zentrale Beiträge zu dem, was wir heute als Deep Learning und generative KI kennen.
Und natürlich entstanden in ganz Europa bedeutsame Grundlagenarbeiten. So wurden etwa neuronale Sprachmodelle, die einen Grundstein heutiger LLMs legten, maßgeblich von europäischen Forschenden entwickelt – allerdings überwiegend während ihrer weiteren Karriere in den USA.
Genau hier liegt das Problem: Die Möglichkeiten, auf Weltniveau industrienahe KI-Forschung zu betreiben, sind in Europa nach wie vor begrenzt. Ein großer Teil der Spitzenforschung findet heute in Unternehmen statt – und für europäische Forschende bedeutet das oft, in Labs amerikanischer oder chinesischer Konzerne zu arbeiten. Neben den USA und China drängen mittlerweile auch die Golfstaaten mit massiven Investitionen, eigenen KI-Hubs und offensiven Talentprogrammen nach vorne.
Wer als Spitzenkraft global mobil ist, findet außerhalb Europas nicht nur größere Rechenressourcen und mehr Risikokapital, sondern häufig auch deutlich höhere Gehälter und Beteiligungsmodelle. Europäische KI-Startups wiederum erleben immer wieder, dass ihre erfolgreichsten Teams am Ende von genau diesen Akteuren aufgekauft werden.
Europa ist also noch Mitspieler, aber ohne strategische Kehrtwende droht die Zuschauerrolle. Wenn wir Talente halten, offene Recheninfrastruktur aufbauen, mutiger in skalierbare KI-Unternehmen investieren und Regulierung als Standortvorteil statt als Innovationsbremse nutzen, kann Europa eine eigene, starke Rolle einnehmen: als Kontinent, der leistungsfähige KI mit klaren Werten und gesellschaftlichem Nutzen verbindet – gerade in sensiblen Bereichen wie Gesundheit, Bildung und öffentlicher Daseinsvorsorge. Ohne diese Anstrengung werden wir zwar weiter über KI reden – aber immer häufiger über Technologien, die anderswo entschieden wurden.
Welche Frage sollen wir als Nächstes stellen?
Wir lesen jede einzelne Nachricht und Dein Feedback fließt in die nächste Ausgabe ein – klicke auf den Button unten, um deine Frage einzureichen.
Das war’s schon! 😔
Mehr davon? Hol Dir jetzt KI Weekly Plus (kostenlos testen!).